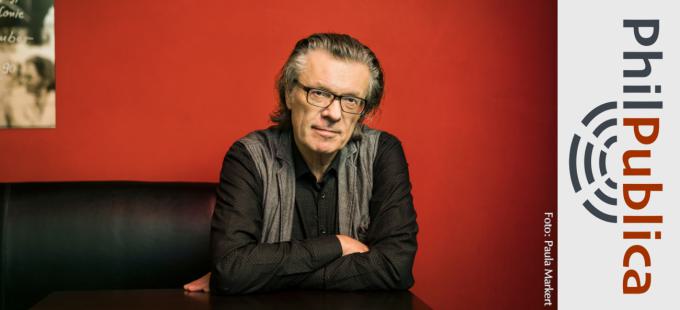Was ich noch sagen wollte
PhilPublica stellt vor

Sabine Döring
Welcher philosophische Text hat Ihr Leben verändert?
Robert Musils sogenannte „Gefühlspsychologie“, und zwar lange bevor Musil überhaupt als Philosoph betrachtet wurde. Musil entwickelt hier eine komplexe Theorie darüber, wie Emotionen unsere Wahrnehmung bestimmen, die meinen eigenen Ansatz maßgeblich geprägt hat.
Woran arbeiten Sie gerade?
Immer noch zu den Emotionen. Mich interessiert zunehmend ihre Rolle im Zusammenleben und der Politik. Meine Hypothese ist, dass Emotionen wie Angst, Ressentiment, Empörung oder Billigung als „kollektive Emotionen“ zwar individuell erlebt werden, aber voraussetzen, dass das Individuum Teil einer Gemeinschaft ist. Damit möchte ich dazu beitragen, solche Emotionen besser zu verstehen und insbesondere zu klären, unter welchen Bedingungen sie in einer Gemeinschaft sich wechselseitig als frei und gleich anerkennender Individuen angemessen sein können. Teil dieses (nicht zuletzt auf Peter Strawsons „reaktive Einstellungen“ zurückgehenden) Projektes ist auch die Frage nach der Rationalität und Moralität unserer Einstellungen zu Risiko und Unsicherheit. Die Pandemie hat uns deutlicher denn je vor Augen geführt, dass unsere Handlungen externe Effekte haben, auch unbedachte oder unbeabsichtigte. Das müssen wir unseren Entscheidungen berücksichtigen. Diese Einsicht ist zugleich grundlegend für ein reflektiertes Verständnis von Freiheit.
Was außerhalb der Philosophie hat Sie am meisten geprägt?
Der Umgang mit Pferden und domestizierten Tieren allgemein. Wem hier die Erfahrung und Expertise fehlt, der wird zwangsläufig dazu neigen, Tiere entweder wie Menschen oder wie Wildtiere zu verstehen. Beides ist falsch.
Welches Vorurteil gegenüber akademischen Philosophen ärgert sie am meisten?
Viele Nicht-Philosophen gehen irrigerweise davon aus, dass Philosophie keine methodischen und begrifflichen Grundkenntnisse voraussetzt: „Jeder ist ein Philosoph“; „akademische Philosophen ‚philosophieren‘ ja auch bloß“. In Wahrheit ist Philosophie methodisch nicht weniger anspruchsvoll als etwa Mathematik oder Physik. Teilweise tragen wir akademische Philosophen zu diesem Vorurteil selbst bei, wenn wir nämlich nicht dafür sorgen, dass man einen Abschluss in Philosophie nur mit den erforderlichen Grundkenntnissen erwerben kann. Wir sind gefordert, nicht nur über unsere jeweiligen Steckenpferde zu lehren.
Ist es immer gut, vernünftig zu sein?
Ein angemessenes und nicht unterkomplexes Verständnis von Vernunft vorausgesetzt: ja. Vielfach werden Vernunft und Emotion als Opponenten betrachtet. Hat man die Emotionen aber einmal in die Vernunft integriert, erweisen sich Konflikte zwischen dem, was man für wahr hält, und widerspenstigen Emotionen als unverzichtbare rationale Konflikte: Ohne die Emotionen kämen wir manchmal gar nicht zu bestimmten Einsichten.
Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Das Standardbeispiel stellt Mark Twain bereit: Nachdem Huckleberry Finn dem Sklaven Jim zur Flucht verholfen hat, überkommen ihn Gewissensbisse, und er entschließt sich, Jim den Sklavenjägern auszuliefern. Doch dann sieht er sich genau das Gegenteil tun: Statt Jim zu verraten, lügt er, um Jim zu beschützen. Es sind seine wachsende Freundschaft und sein Mitgefühl mit Jim, die Huck dazu bewegen, etwas zu tun, was nach allen ihm vertrauten Moralprinzipien falsch ist. Was dieses Beispiel interessant macht, ist, dass Hucks affektive Wahrnehmung von Jim als einem freien und gleichen Menschen, ja Freund, nicht aus den Moralprinzipien folgt, die er bisher akzeptiert hatte. Vielmehr sind es seine Emotionen, die Huck am Ende dazu bewegen, neue und bessere Moralprinzipien zu formulieren. Er gelangt durch seine Gefühle zur vernünftigen Einsicht, dass man manchmal lügen darf.
Warum schreiben Sie für die außerakademische Öffentlichkeit?
Philosophische Einsichten werden in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. Positionen, die wir in der öffentlichen Debatte unter dem Namen „Philosophie“ vorfinden, spielen in der wissenschaftlichen Debatte oftmals keine Rolle, und die zugrundeliegende Argumentation unterschreitet oftmals methodische Minimalstandards. Ich möchte dazu beitragen, dies zu ändern. Wie alle Wissenschaft ist Philosophie komplex, abwägend, es gibt widerstreitende Positionen, und diese werden auch noch ständig revidiert. In der Philosophie kommt noch hinzu, dass es schwierig zu sein scheint, Nicht-Philosophen die spezifisch philosophische Herangehensweise nahezubringen. Ein Grund hierfür ist, dass Philosophie typischerweise als selbstverständlich Erachtetes (radikal) in Frage stellt.