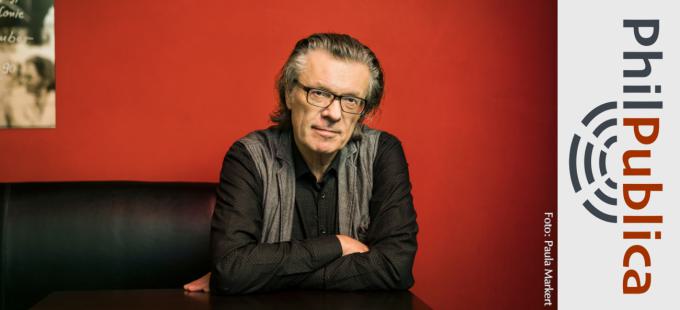Was ich noch sagen wollte
PhilPublica stellt vor

Daniel Martin Feige
Was war Ihr erster Kontakt mit der Philosophie?
Die Kant-, Nietzsche- und Heidegger-Ausgaben im Bücherregal meines Vaters. Ich blätterte darin und verstand so gut wie gar nichts. Eine solche Erfahrung hat mich immer motiviert, mich mit einer Sache eingehender zu beschäftigen, anstatt resigniert aufzugeben.
Was außerhalb der Philosophie hat Sie am meisten geprägt?
Die Künste, hier vor allem Musik, Literatur und Film. Vor meinem Philosophiestudium habe ich Jazzklavier studiert und täglich mehrere Stunden am Instrument geübt. Ich habe dort auch vieles für meine Praxis des Schreibens mitnehmen können. In den letzten Jahren aber vor allem meine Kinder; Kinder zu haben, verwandelt das Weltverhältnis grundsätzlich.
Welche philosophische Auffassung, von der Sie einmal überzeugt waren, haben Sie aufgegeben?
Im Studium habe ich mich die ersten Jahre vor allem für Fragen der Wissenschaftstheorie begeistert und dabei mit evolutionspsychologischen und soziobiologischen Theorien sympathisiert. Dann geriet ich durch den Lehrstuhl meines Doktorvaters zunehmend in den Kontakt mit den philosophischen Klassikern und jüngeren Beiträgen der angloamerikanischen und französischen Philosophie, die mir deutlich gemacht haben, dass bei den oben genannten Theorien philosophisch nichts zu holen ist.
Können Sie das genauer erklären? Warum ist in den genannten Theorien philosophisch nichts zu holen?
Sie arbeiten mit einem reduzierten Begriff der Rationalität des Menschen. Deshalb bekommen sie zentrale Dimensionen dessen, was uns auszeichnet, nur systematisch verzerrt in den Blick. Spielarten eines nicht-reduktiven Naturalismus scheinen mir deshalb weiterführender zu sein. In jedem Fall hilft die Philosophie nicht allein dabei, liebgewonnene Überzeugungen in Frage zu stellen (man kann durch sie etwas lernen). Vielmehr sieht man auch klarer, welche Fragen gute und schlechte, verständliche und unverständliche Fragen sind.
Woran arbeiten Sie gerade?
Jüngst habe ich ein Buch zu einer kritischen Theorie der Digitalisierung abgeschlossen, das die Neutralität digitaler Technologien ebenso wie die Zuschreibung geistiger Fähigkeiten an KIs hinterfragt.
Worin besteht denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung der KI für die Philosophie?
Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Frage, ob und inwieweit eine KI denken kann. Das halte ich für die falsche Frage. Wir bauen damit faktisch unseren Begriff des Denkens um (und den Begriff unserer selbst als geistiger Wesen). Ein solches Vorgehen hat eine praktische Dimension und eine politische Grammatik: Wir spielen damit das Spiel der großen Tech-Unternehmen, deren KI-Entwicklung mit handfesten ökonomischen Interessen einhergeht, und die dabei auch nicht vor umfangreichen Verletzungen geistigen Eigentums zurückschrecken. Die Gefahr besteht kurz gesagt darin, die Entwicklung der KI (aus theoretischer Perspektive) zu ernst zu nehmen oder sie (aus praktischer Perspektive) zu wenig ernst zu nehmen.
Welche philosophischen Ressourcen nutzen Sie für Ihre Kritik?
Von entscheidender Bedeutung für mein Denken und auch die Argumentation im gerade abgeschlossenen Buch ist neben der kritischen Theorie die klassische deutsche Philosophie und ihre angloamerikanische Rezeption. Zentral ist hier für mich John McDowell; derzeit schreibe ich eine Einführung in seine Philosophie. Von McDowell lässt sich lernen, dass ein denkendes Wesen zu sein heißt ein Wesen zu sein, dass ein Begriff seiner selbst als eines denkenden Wesens hat. Das können wir einer KI nicht zuschreiben. Schon länger schreibe ich zudem an einem Buch zur Philosophie des Horrors (mit filmtheoretischem Schwerpunkt).
Was stört Sie an der akademischen Philosophie?
Dass in ihr mitunter noch ein Lagerdenken vorherrscht. Ich hatte das Privileg in meiner akademischen Laufbahn mit verschiedenen Traditionen und Denkschulen der Philosophie konfrontiert zu werden. Auch für die Philosophie gilt: Bonum est multiplex.