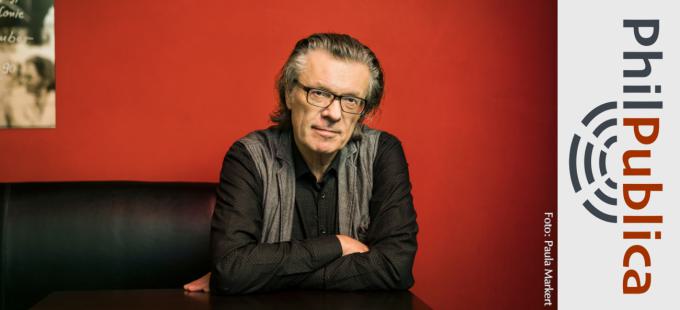Was ich noch sagen wollte
PhilPublica stellt vor

Holger Lyre
Was war Ihr erster „richtiger“ Kontakt mit der Philosophie?
Schon in frühen Jugendjahren hatte ich von „Philosophie“ gelesen, wusste aber lange nicht genau, was ich darunter zu verstehen hatte. Schließlich kam das erste Halbjahr des Philosophie-Grundkurses der Oberstufe. Wir diskutierten Kants berühmte Passage zur Kopernikanischen Wende aus der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Der dort vorgestellte Gedanke, dass die Welt sich in gewisser Weise nach unserem Erkenntnisvermögen richtet, hat mich wie der Blitz getroffen. Ich erlebte, vielleicht zum ersten Mal, die Faszination und Genugtuung eines wahrhaft tiefen Gedankens. Vor allem in den Jahren des Studiums folgten zahlreiche Erlebnisse dieser Art in Philosophie und Wissenschaft. Für mich waren und sind solche Momente der eigentliche Ansporn – und ich vermute, ich bin da nicht allein. Leider werden sie mit steigendem Alter und Erfahrung immer seltener.
Könnten Sie philosophische „Helden“ benennen?
Ich nenne zunächst Kant und Weizsäcker, auch wenn ich ihre grundsätzlichen Positionen heute nicht mehr teile. Aber der Einfluss ihres Denkens auf mich war zweifellos groß. Ansonsten: Hume, Wittgenstein und Dennett.
Würden Sie Ihren Kindern dazu raten, Philosophie zu studieren?
Ja, aber nie als alleiniges Fach, sondern nur im Verbund mit einer anderen Disziplin. Das war auch der Weg, den ich persönlich in die Philosophie genommen habe: Ich begann als Physiker, habe mich dann den philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften zugewendet und bin schließlich ganz in die akademische Philosophie übergewechselt. Eine andere Möglichkeit bilden interdisziplinäre Studiengänge wie unser Magdeburger Programm „Philosophie – Neurowissenschaften – Kognition“. Wer dieses Programm mit guten Leistungen absolviert, erwirbt etwas sehr Wertvolles: eine Doppelqualifikation in Geistes- und Naturwissenschaften (im pädagogischen Neusprech: eine Querschnittskompetenz).
Welche philosophische Auffassung, von der Sie einmal überzeugt waren, haben Sie aufgegeben?
Mein spezifischer Einstieg in die Philosophie waren die Interpretationsprobleme der Quantentheorie (also Fragen nach Messprozess, Realismus und Rolle des Beobachters). Hier habe ich sehr bald eine anti-realistische und dann eine speziell kantische Position eingenommen. Mein philosophischer Ziehvater wurde Carl Friedrich von Weizsäcker. Ich verdanke auch meinem Doktorvater, Michael Drieschner, seinerseits Weizsäcker-Doktorand, in dieser Hinsicht sehr viel. Weizsäcker verfolgte das heroische Ziel einer Quantentheorie a priori und eines darauf fußenden Grundlagenprogramms zur Einheit der Physik. Ich war absolut fasziniert und wurde ein engagierter Mitstreiter. Erst nach der Promotion begann ich die vor allem mathematisch-technischen Defizite des Programms wahrzuhaben und entwickelte mich philosophisch mehr und mehr zum wissenschaftlichen Realisten. In allerjüngster Zeit kommen mir auch hier wieder Zweifel. Sie speisen sich nun nicht mehr aus den philosophischen Problemen der Physik (die nach wie vor ungelöst sind), sondern aus erkenntnistheoretischen Konsequenzen der Neurokognition und KI.
Wo verorten Sie sich auf der philosophischen Landkarte? Welchen philosophischen Positionen stehen sie am nächsten?
Rundheraus: Ich neige einem Physikalismus, Realismus und Reduktionismus zu. Schon jede einzelne dieser Positionen gilt vielen als „politisch inkorrekt“, aber dann auch noch im Dreierbund!? Vor allem in den Geisteswissenschaften sind modische Abwehrreflexe gegenüber jeder dieser Positionen weitverbreitet. Leider, und das muss ich hier zu Protokoll geben, haben diese Reflexe nicht selten mit einem beklagenswerten Mangel an Kenntnissen in den formalen und empirischen Wissenschaften zu tun. Und trotz dieser offenkundigen Mängel ist erschreckend vielen Philosoph*innen aus gewissen Lagern nicht bange, starke Behauptungen ohne große intellektuelle Selbstzweifel aufzustellen. Das verstört mich immer wieder aufs Neue.
Ist die Philosophie eine Wissenschaft?
Idealerweise ja, de facto leider nein. Denn es ist ein Faktum, dass es professionelle Philosoph*innen gibt, zu deren Doktrin es gehört, die Frage zu verneinen. Ich persönlich – und nach meiner Wahrnehmung auch die große Mehrheit – sehe es anders. Im Mittelpunkt philosophischer Arbeit steht das systematische und methodische Argumentieren. Das ist eine mühsame und herausfordernde Angelegenheit, die gelernt sein will und unter methodischen Standards steht. Philosophiererei ohne diese methodische Anstrengung ist im besten Fall unterhaltsame Spekulation, im schlechtesten Fall einfach nur Humbug. Hinzu kommt: Zu (fast) jeder philosophischen Frage gibt es heute relevante Fachwissenschaften, die fundierte empirische Kenntnisse bereitstellen. Die Philosophie ist unbedingt gehalten, diese Kenntnisse mit einzubeziehen. Sie ist daher auch nicht die Königin der Wissenschaften, aber ein wichtiges Instrument im wissenschaftlichen Orchester.
Erhält die Philosophie zu wenig Aufmerksamkeit?
Fast möchte ich sagen: leider nein, denn häufig erhalten falsche Propheten Aufmerksamkeit über Gebühr, gerade in den Medien. Philosophie als Wissenschaft, also die soeben beschriebene methodisch und systematisch strenge Philosophie erhält zu wenig Aufmerksamkeit. Sie stellt auch eine gewisse Überforderung für die Medien dar und entspricht nicht dem immer noch vorherrschenden naiv-romantischen Bild von der Philosophie als wortgewaltig und nebulös, einem leider bis in die Feuilleton-Redaktionen der sogenannten Qualitätsmedien dominanten Vorurteil. Hieran können letztlich nur wir, die Kolleginnen und Kollegen in der wissenschaftsorientierten Philosophie etwas ändern. Man muss sich dann allerdings damit arrangieren, dass der Gang in die mediale Öffentlichkeit typischerweise mit Verkürzungen und Verzerrungen einhergeht. PhilPublica ist insofern ein gute Initiative.
Woran arbeiten Sie gerade?
Mein Dauerthema lautet Strukturalismus. Man könnte es grob so darstellen: In den ersten gut fünfzehn Jahren meiner Tätigkeit habe ich mich im Rahmen der Philosophie der Physik mit den Grundlagen der Natur beschäftigt, der Objektseite also. In den zweiten, mittlerweile vergangenen fünfzehn Jahren habe ich mich mehr und mehr auf das Mentale und somit auf die Subjektseite fokussiert. Beide Male bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ein Strukturalismus die weitaus plausibelste Konzeption bietet. Das heißt: ich vertrete, wie übrigens viele, einen Strukturenrealismus bezüglich der Natur, denn diese Position ist am ehesten mit der modernen Physik verträglich. Nach dieser Auffassung sind die fundamentalen Entitäten unserer Welt ontologisch ausschließlich über relationale Eigenschaften individuiert. Gleichzeitig lässt sich unsere Erkenntnis der Welt am plausibelsten auf der Basis strukturaler mentaler Repräsentationen verstehen. Und hier denke ich nicht nur an Intentionalität, sondern auch an phänomenales Bewusstsein. Objekt- und Subjektseite nun zusammen zu denken, ist mein noch offenes, übergeordnetes Projekt.
Und welche Bedeutung hat Künstliche Intelligenz für Sie?
Ich bin überzeugt: wir erleben eine Zeitenwende von der Größenordnung der Einführung des Buchdrucks oder der Dampfmaschine. KI ist keine Technologie wie jede andere. Sie birgt die völlig neuartige Möglichkeit in sich, sich ab einer gewissen Schwelle aus eigener Kraft zu beschleunigen und den Menschen zu überflügeln. KI ist zwar kein neues Thema, aber erst mit den Deep Learning-Durchbrüchen neuronaler KI und den Selbstlern-Fähigkeiten generativer Modelle ab den 2010er Jahren kommt die nun allseits sichtbare, ungeheure Beschleunigung ins Spiel, die gleichermaßen faszinierend wie alarmierend ist.
Inwiefern ist sie alarmierend?
Wir müssen verstehen, dass menschliches Denken nicht der alleinige Maßstab für Intelligenz und Kognition ist, sondern dass es andersartige Formen gibt, die uns in manchen Hinsichten unterlegen, in anderen aber bei weitem überlegen sind. Avancierte KI-Systeme sind wie eine andere Spezies. Die häufig diskutierte Frage nach KI-Bewusstsein steht für mich dabei gar nicht mal im Vordergrund, statt dessen die Möglichkeit, dass avancierte Systeme die Fähigkeit erlangen, stärkere Systeme hervorzubringen. Auch wir Menschen besitzen diese Fähigkeit, und es wäre falsch und fatal, sich dahingehend zu beruhigen, dass dies KI-Systemen versperrt ist.
Was ich noch sagen wollte
Zu viel Philosophie ist nicht gut, aber an guter Philosophie kann es nicht zu viel geben.